Nicht einfach andere Dinge machen, sondern die Dinge anders machen
Diesem kirchenentwicklerischen Grundsatz folgte das Seminar „Ecclesiopreneurship – Kirchen anders denken und machen“, das im Sommersemester am Lehrstuhl Pastoraltheologie stattfand. Der folgende Beitrag skizziert zentrale Impulse aus dem Lehrformat und zeigt, warum sich die Methode Design Thinking als besonders geeignet erweist, um komplexe Herausforderungen in der Kirche innovativ und kontextsensibel anzugehen.
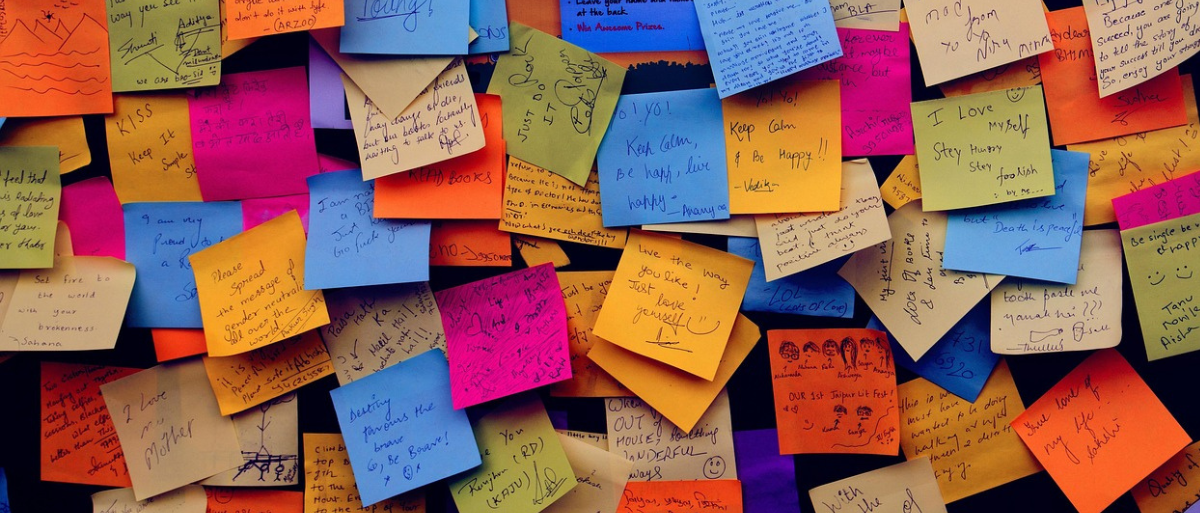
Komplexitätsdiagnose – Mehr als ein intellektuelles Achselzucken
„Das ist komplex.“ Diese Wendung dient im Alltag oft als elaborierte Umschreibung von Ratlosigkeit. Doch im Kontext von Kirchenentwicklung hat die Diagnose eine klärende und richtungsweisende Funktion. Sie macht darauf aufmerksam, welcher Modus des Entscheidens und Arbeitens angemessen ist. Nach dem Cynefin Framework, einem Modell zur Entscheidungsfindung in unterschiedlichen Handlungssituationen, lassen sich komplizierte und komplexe Situationen wie folgt unterscheiden: Komplizierte Probleme lassen sich mit Analyse, Planung und Expert:innenwissen bewältigen – hier bestehen klare Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge. Komplexe Situationen hingegen sind geprägt durch Unvorhersehbarkeit, Dynamik und Offenheit. Sie lassen sich nicht durch lineare Entwicklungspläne bearbeiten.[1] „Kein Expert*innengremium und auch kein Geld der Welt, kein Projektmanagement und keine Erfahrung,“ so bringt es Maria Herrmann auf den Punkt „kann komplexe Probleme durch direktes Einwirken lösen.“[2] Lösungen für komplexe Herausforderungen entstehen durch Ausprobieren, Wahrnehmen und Reagieren. Es gilt, mit der Unsicherheit produktiv umzugehen und durch kleine Schritte[3] und kreative Experimente neue Wege zu entdecken.
Design Thinking: Eine geeignete Methode für komplexe Herausforderungen
Design Thinking wurde ursprünglich für die Produktentwicklung und Innovationsforschung entwickelt. Heute wird die Methode weltweit in Bildung, Sozialarbeit, Stadtplanung und zunehmend auch in kirchlichen Kontexten angewendet. Sie eignet sich besonders für sogenannte „wicked problems“ – Problemstellungen, bei denen sich Ziele und Lösungen erst im Prozess klären, weil Interessenslagen, Perspektiven und Kontexte vielfältig und widersprüchlich sind.[4] Also für Fragestellungen, wie sie auch im Cynefin Framework als komplex beschrieben werden: ohne eindeutige Lösungen, dynamisch und von vielen Perspektiven geprägt.
Charakteristisch für Design Thinking ist erstens eine radikale Nutzer:innenorientierung. Es geht darum, die echten Bedürfnisse der Menschen zu verstehen. Zweitens setzt die Methode auf interdisziplinäre Zusammenarbeit, denn Vielfalt erzeugt bessere Ideen. Drittens wird bewusst auf ein iteratives Vorgehen gesetzt. Anstelle linearer Pläne folgt die Methode dem Prinzip des Denkens in Schleifen mit Phasen des Ausprobierens, Reflektierens und Weiterentwickelns.[5]
Im Seminar durchliefen wir die sechs typischen Phasen von Design Thinking: Verstehen – Beobachten – Standpunkt finden – Ideen entwickeln – Prototypen bauen – Feedback einholen. Ziel war nicht Perfektion, sondern die Entwicklung konkreter, greifbarer Prototypen als erste Antworten auf reale Herausforderungen in der Seelsorge.
Von echten Problemen ausgehen
Im Zentrum des Seminars standen konkrete Herausforderungen aus der pastoralen Praxis, die im Vorfeld über einen Aufruf innerhalb des Erzbistums gesammelt wurden:
So sollte etwa in Villingen ein durch Jugendliche neugestalteter Kirchenraum dauerhaft erhalten bleiben und multifunktional genutzt werden – sowohl als liturgischer Raum als auch als Begegnungsort. Doch wie kann das gelingen? Und wie lassen sich dabei Menschen vor Ort mit in diesen Prozess einbeziehen?
Im Schutterwald fehlte bisher jedes Angebot für Menschen im Übergang in den Ruhestand. Eine existenzielle Lebensphase voller Fragen nach Identität, Sinn und Vergänglichkeit. Wie kann Kirche hier seelsorglich tätig werden?
In Freiburg-Stühlinger stellte sich die Frage, wie eine Pfarrei ohne stabile Gemeindestruktur ein neues Profil entwickeln kann. Der Kirchplatz ist geprägt von vielfältigen sozialen Spannungen und die Kirche ist inhaltlich kaum präsent im Stadtteil. Wie kann sich die Gemeinde hier künftig sozialräumlich positionieren, offen und einladend auftreten?
Die Probleme schleifen und ab dann: Quick and dirty
Der Design-Thinking-Prozess hat unseren Blick auf Probleme verschoben und uns ermutigt, erste Ideen in konkrete Prototypen zu übersetzen. Wir lernten, nicht zu früh zu urteilen, sondern erst einmal genau hinzuschauen – durch Interviews, Perspektivwechsel und Empathiearbeit. Wir lernten aber auch, nicht zu lange mit dem Entwickeln konkreter Lösungsideen zu warten. Dabei merkten wir, wie wertvoll es ist, Ideen durch Skizzen unperfekt sichtbar zu machen und möglichst früh, anderen davon zu erzählen. In der abschließenden Präsentation im Rahmen des Regionalgruppentreffens der Freiburger Pastoralreferent:innen stießen die Prototypen auf echte Resonanz. Es war spannend, unsere Prototypen vor erfahrenen Praktiker:innen zu präsentieren und dabei ehrlich, differenziertes Feedback zu bekommen. Dieser geschulte Blick half, die Relevanz und Umsetzbarkeit unserer Idee kritisch zu prüfen und zeigte einmal mehr, wie wichtig es ist, nah an realen Problemen zu bleiben, statt an der Zielgruppe vorbeizuentwickeln.
Was bleibt? Design Thinking ist mehr als eine praktische Methode für Kirchenentwicklung. Sie ist eine Haltung des neugierigen, experimentierenden, lernenden Handelns. Gerade für Kirchen, die sich immer wieder neu zu den Menschen aufmachen muss, kann das eine große Chance sein. Design Thinking lädt dazu ein, nicht nur neue Formate zu erfinden oder Projekte zu entwickeln, sondern auch das eigene Denken und Handeln grundlegend zu hinterfragen. Es geht nicht darum, Bewährtes einfach durch Neues zu ersetzen, sondern darum, die Art und Weise zu verändern, wie wir Probleme angehen: nutzer:innenorientiert, lernbereit und mit den Menschen, für die wir Kirche sind.
[1] Das Cynefin Framework wurde Anfang der 2000er Jahre vom walisischen Managementberater Dave Snowden entwickelt, um Entscheidungsprozesse in Organisationen differenzierter zu erfassen. Er unterscheidet zwischen verschiedenen Handlungskontexten (einfach, kompliziert, komplex, chaotisch) und schlägt jeweils angemessene Reaktionsmuster vor. Besonders der Umgang mit komplexen Situationen, gewinnt in Transformationsprozessen, wie sie etwa in der Kirchenentwicklung zu beobachten sind, an Bedeutung. Vgl. BROUGHAM, Greg: The Cynefin Mini-Book, Raleigh 2015. Die Übertragung des Cynefin Frameworks auf Fragen der Kirchenentwicklung geht auf einen Hinweis von Maria Herrmann zurück.
[2] HERRMANN, Maria: Wer ist WIR? Fragmentarität in Gesellschaft, Kirche und Pastoraltheologie, in: Zeitschrift für Pastoraltheologie, 02/2024, S. 45-55, hier: S. 49.
[3] Vgl. NASSEHI, Armin: Kritik der großen Geste. Anders über gesellschaftliche Transformation nachdenken, München 2024, S. 218.
[4] Vgl. ERBELDINGER, Jürgen; RAMGE, Thomas: Durch die Decke denken. Design Thinking in der Praxis, München 2013, 30.
[5] Vgl. ERBELDINGER, Jürgen; RAMGE, Thomas: Durch die Decke denken. Design Thinking in der Praxis, München 2013, 13.

Stephanie Gans
Stephanie Gans studiert seit Oktober 2019 an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg katholische Theologie auf Magister. Von Oktober 2022 bis Juli 2023 war sie Teil des Theologischen Studienjahrs in Berlin und legte somit einen theologischen Schwerpunkt auf die Themen Spiritualität, Urbanität und Säkularität.
Weitere passende Beiträge
Diskutieren Sie mit uns!


